37. Il Cinema Ritrovato Bologna
Bollywood auf der Piazza Maggiore: »Sholay« (1975)
1986 startet Il Cinema Ritrovato als Fachevent, 2025 ist es ein Publikumsmagnet mit zahlreichen Fans alter Filme, die ihre Festivalpässe ausgiebig nutzten
In Bologna prallen Gegensätze aufeinander, teils sogar beim selben Screening: Bahram Bayzais 35-Minüter »The Journey« (1972) hätte mit seiner visuell aufgeladenen Geschichte eines Waisenjungen in Teheran, der sich ständig neu einredet, seine Eltern finden zu können, auf einen dynamischen zweiten Film einstimmen können. Es folgte aber der venezolanisch-kolumbianische »La Paga« (1962), dessen erzählerische Langsamkeit die Lebensrealität eines ausgebeuteten Bauern spiegelt. Die Filme sind Teil der Sektion Cinemalibero, die unterrepräsentiertes Weltkino abbildet und auch den einst vom italienischen TV beauftragten brasilianischen Spielfilm »Uirà« (1973) ans Licht brachte. Darin zieht eine indigene Familie nach dem Tod eines Sohnes los, um Gott zu suchen, findet aber das Übel der Zivilisation – ein spannender kultureller Einblick und eine Anklage zugleich. Statt in die weite Welt entführt der simpel, aber effektiv inszenierte tunesische Film »Al Ôrs« (1978) in das Haus zweier frisch Verheirateter: In einem intensiven Kammerspiel lügen, streiten und verletzen sie sich, während ihr abrissreifes Haus sinnbildlich zerfällt.
Kontrast zu derlei harter Kost bot die Subsektion Pratello Pop mit Guilty Pleasures wie Lucio Fulcis Giallo »Don’t Torture a Duckling« (1972) oder Mario Bavas »Danger: Diabolik« (1968). Die Verfilmung des italienischen Comics »Diabolik« feiert den visuellen Exzess ihres dank Restaurierung besonders strahlenden Produktionsdesigns mit herrlicher Unverfrorenheit.
Filmschaffenden wie Luigi Comencini, Lewis Milestone, Mikio Naruse und Coline Serreau hatte das Festival je eigene Reihen gewidmet. Serreaus »Green Planet« (1996) wurde nur nachträglich aufgenommen, weil die Regisseurin ihre Werke über Ökologie im Programm vermisst hatte. Die Öko-Komödie, in der eine von Serreau gespielte menschenähnliche Außerirdische die Erde aufsucht, ist mehr »Bill and Ted« als Intellektuellenkino und damit sehr reizvoll, rechtfertigt aber auch die ursprüngliche Auslassung: Die Handlung ist platt, der Humor albern und die Haltung etwas selbstverliebt.
US-Filmkritikerin Molly Haskell setzte bei ihrer Reihe zu Katharine Hepburn auf eigene Vorlieben und viel 35 mm. So schaffte es ein Film wie »Desk Set« (1957) auf die Leinwand, dessen Thema – die Einführung einer Art KI in der Rechercheabteilung eines Rundfunksenders – den Film erstaunlich aktuell macht. Hepburns Dynamik mit Spencer Tracy ist ohnehin zeitlos, nur gebremst durch ein paar Drehbuchschwächen. Ganz anders sieht es in »Adam’s Rib« (1949) aus, der Hepburn und Tracy als gegnerische Anwälte zeigt, die daheim eine liebevolle, neckische Ehe führen. Die Komödie von George Cukor zum Thema Gleichberechtigung vermeidet fast alle Misstöne und ist fantastisch gealtert. Neben den üblichen Screwball-Highlights liefern Filme wie »Alice Adams« (1935) oder »Summertime« (1955) (melo-)dramatischere Töne. In Letzterem betont Regisseur David Lean so sehr die Vorzüge der Stadt Venedig, als habe ihn die dortige Tourismusbehörde bezahlt. Daneben macht Hepburns schöne Darstellung von Verletzlichkeit und Einsamkeit den Film sehenswert.
Die spätabendlichen Open-Air-Screenings vor Tausenden Menschen waren vom Thema Widerstand geprägt – nicht nur wegen der angenehm klaren politischen Haltung in vielen Filmeinführungen der teils prominenten Gäste. Der Bollywood-Hit »Sholay« (1975) verpackt das Motiv in ein Western-Szenario: Zwei liebenswerte Kriminelle sollen einem pensionierten Polizisten zur Rache verhelfen und einen Bösewicht zu Fall bringen. Dreieinhalb Stunden Laufzeit vergehen dank Gesang, Tanz, Chaplin-Reminiszenzen und reichlich Action wie im Flug. Noch direkter (und propagandistischer) verhandelt Sergej Eisensteins 100 Jahre alter revolutionärer Stummfilm »Streik« (1975) die Auflehnung gegen das Unrecht. Das Screening war ein Highlight dank pumpender elektronisch geprägter Livebegleitung, die das Zelluloid gefühlt durch den Projektor trieb und wie eine intensivierte Version des Scores von »Only Lovers Left Alive« klang. Dessen Regisseur Jim Jarmusch war passenderweise wenige Stunden zuvor für ein anrührendes Werkstattgespräch zu Gast, wie die Tage zuvor schon Terry Gilliam, Asghar Farhadi, Alice Rohrwacher und Jonathan Glazer.

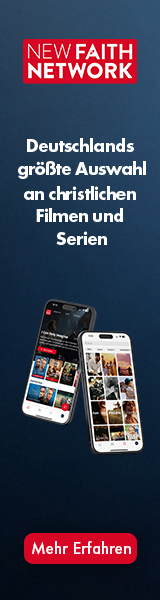
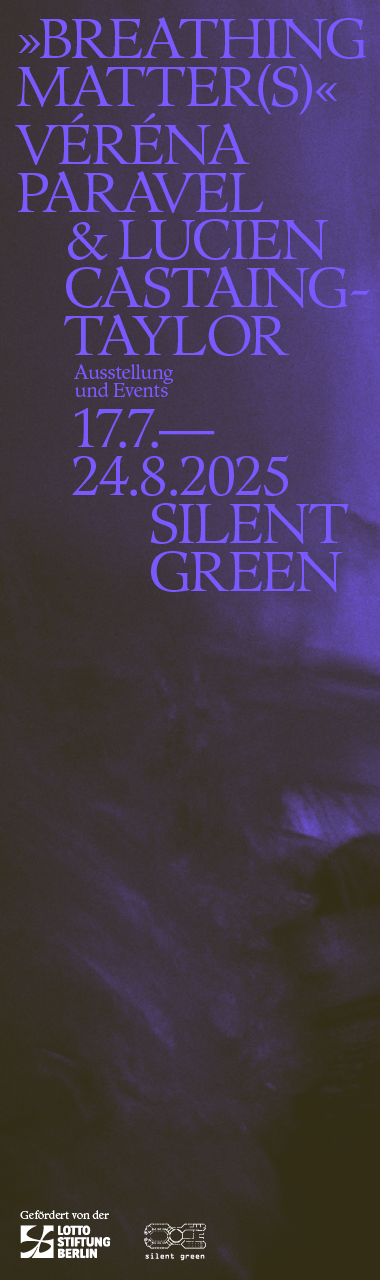
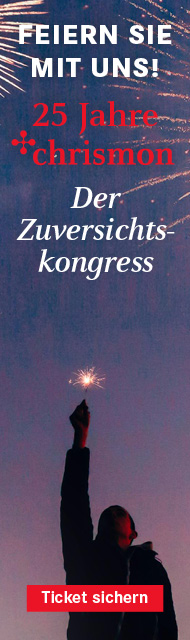
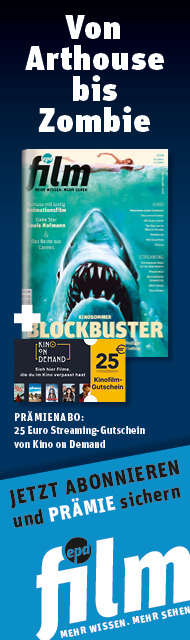
Ihre Meinung ist gefragt, Schreiben Sie uns