Hellsichtig und nebulös
Bei »Resurrection«, dem die Jury in Cannes am Samstag einen Spezialpreis verlieh, scheint es sich um eine Dystopie zu handeln. Bi Gans Film spielt in einer Welt, in der niemand mehr träumen soll. Die Menschheit hat entdeckt, dass der Verzicht aufs Träumen die Lebenserwartung erhöht.
Was ich über ihn las, machte mich neugierig. Es gibt in dieser Welt Rebellen, sogenannte "Phantasmers", die sich dem Traumverbot widersetzen und von einer Abteilung der Polizei verfolgt werden, die speziell dieses Vergehen ahndet. Ob sich die chinesische Zensur in dieser Behörde wiedererkannte? Vor allem scheint der Regisseur eine Zeitreise zu inszenieren, in der verschiedene Epochen durch unterschiedliche Filmstile repräsentiert werden. Klingt alles ziemlich spannend. Das Kino als Traummaschine ist ohnehin ein Thema, das derzeit eine ganze Reihe von Kuratorinnen und Kuratoren interessiert. Dieser Trend fiel mir schon im Frühjahr auf, bei genauerem Hinsehen ist er aber womöglich gar keiner.
Die Ansätze unterscheiden sich sehr von einander. Das Filmforum NRW zeigt von Mai bis Dezember eine Reihe mit dem Titel »Träume von Räumen«. Mit dem Untertitel »Wohnraum im Film« landet man indes sofort wieder im Wachzustand. Es laufen beispielsweise »Das Apartment«, „»Parasite« und der großartige »Neighbouring Sounds« von Kleber Mendonca Filho, aber auch die Utopie kommt mit »Kuhle Wampe«, Tatis »Playtime« und »Zusammen« zu ihrem Recht. Pate für den Titel stand eventuell Siegfried Kracauer, der Raumbilder einmal als die „Träume der Gesellschaft“ bezeichnete, in denen sich soziale Konflikte und Aufbrüche artikulieren. Auch in der Reihe "Phantasiemaschine Kino", die Martin Girod für das Filmpodium Zürich konzipiert hat, geht es weniger um das Traumpotenzial des Kinos, sondern um Filme, die sich einfallsreich den Konventionen entziehen. Im Zentrum steht bis zum 6. Juli die ausscherende Phantasie von Regisseurinnen und Regisseuren, die eine „wache Rezeption“ erfordern. Das Eintauchen in Reverien ist hier nicht erwünscht. Arbeiten von Bunuel, Ildio Enyedi, Med Hondo, Kurosawa, Nelson Pereira dos Santos, Resnais, Szabó und anderen verlangen vom Publikum nicht weniger, als im Kinodunkel mit weit geöffneten Augen zuzuschauen.
„Traummaschine Kino“ im Österreichischen Filmmusuem hingegen setzt sich (ebenfalls bis zum 6. 7.) ausführlich und einigermaßen systematisch mit der Nähe des Mediums zum Traumverhalten auseinander. Der Filmzyklus läuft parallel zu einer Ausstellung in der Schallaburg, die den Titel „Träume...träumen“ trägt. Sie will Tag-, Nacht- und Wunschträumen einen Raum geben. Die Systematik habe ich im vorletzten Satz eingeschränkt, weil die Reihe sich in die Programmpolitik des Filmmuseums einfügt, die eigene Sammlung im Kinosaal auszustellen. "Collection on Screen" heißt diese Unternehmung, die ebenso vernünftig wie kostensparend ist. Dem Einführungstext von Christoph Huber gebricht es ein wenig an jenem feurigen Entdeckerstolz, mit dem hier sonst Filmreihen lanciert werden. Ein aus der Not geborenes Allerweltsthema ist dies jedoch mitnichten, denn der Fokus ist ebenso weltumspannend wie der in Zürich. In Wien wird wirklich mit Eifer, Expertise und Weitblick gesammelt.
Die üblichen Verdächtigen (Bunuel, Lynch, Miyazaki) fehlen nicht. Buster Keaton, der in seinen Langfilmen stets aus einem oder in einen Traum erwacht, ist mit »Sherlock Jr«. vertreten. Die gleichsam industrielle Herstellung von Träumen wird in »Demonlover« von Olivier Assayas und »Vanilla Sky« (mit den "Lucid Dreams", den hellsichtigen Träumen) zum Impulsgeber der Plots. Die Beschäftigung mit Psychoanalyse („Spellbound“, „A Dangerous Method“) verdankt sich schon dem genius loci, aber die Wiener sind eben auch Trüffelschweine, die Werke von Jess Franco, Lev Kuleshov ("Der große Tröster" über O. Henry) und Norbert Pfaffenbichler zeigen. Disneys klassische Trickfilme treffen auf die Avantgarde von Maya Deren und Hans Richter. Dem Faszinosum der "Traumzeit" in »The Last Wave« begenete ich erst unlängst wieder, als ich Peter Weirs Film für meinen Nachruf auf Richard Chamberlain sichtete. Der Amnesiekrimi »Man in the Dark« von Lew Landers, der heute Abend läuft, scheint eine echte Trouvaille zu sein.
Das Stummfilmkino, dem traditionell eine besondere Verwandtschaft zum Traum nachgesagt wird, bleibt erstaunlich unterbelichtet im Programm. Jean Epstein taucht nur in der Einführung auf. Manchmal schrecken schlaue Kuratoren vor dem Offensichtlichen zurück. Klaus Kreimeier schreibt in "Traum und Exzess", seiner exzellenten Kulturgeschichte des frühen Kinos, von ephemeren Energien, dem elektrischen Licht und dem Wasser, die hier beieinander sind, dem Fließen und Strömen. Gestern stieß ich auf eine Rede, die Hugo von Hofmannsthal 1921 zu dem Thema hielt. (Ihr Wortlaut ist leicht auffindbar im Netz.) Der Schriftsteller betrachtet den Film als einen "Ersatz für die Träume", dabei meint er eigentlich, dass die filmischen Illusionen dem Großteil des Publikums eine Erfüllung anbieten, die das Leben für sie nicht bereithält. Der finstere Saal und die beweglichen Bilder führen es in die Kindheit zurück, in der man sich mächtig fühlen konnte. 1921 war das Kino noch „stumm wie die Träume“. Hatte er denn keine Filme mit Musikbegleitung oder Erzählern gesehen? Änderte sich seine Wahrnehmung nicht mit dem Aufkommen des Tonfilms?
Mein eigenes, ziemlich reges Traumverhalten widerspricht ihm nicht unbedingt. Dialoge spielen darin eine wichtige Rolle, erklingt aber eher gedämpft, wie mir beim Aufwachen erscheint. Für andere Geräusche kann ich mich übrigens nicht verbürgen, das bleibt angemessen nebulös. Zwischentitel haben meine Träume jedenfalls nicht. Anders als im Kino fühle ich mich auch selten in eine Gegenrealität entrückt. Von Kreimeiers Bilderfluten keine Spur, von Entgrenzung mitunter schon. Es sind vielmehr die berühmten Tagesreste, die sich in meinem Schlummer zu Wort melden. Für die, scheint mir, eignet sich das Kino nicht. Sie sind ihm zu punktuell, es beschäftigen die Jahres-, die Lebensreste mehr. Der Traum im Kino ist meist großflächiger, umfassender. Er erzählt Geschichten. Dabei sind Träume doch willkürlich, sie fügen sich nicht nahtlos in Erzählkonventionen. Wachen wir nicht in der Regel vor dem Ende auf? Deshalb entspricht der Avantgardefilm, das Experimentelle der Traumlogik wohl tatsächlich mehr. Die Auswahl in Wien stellt dieses Verhältnis mit jedem Film neu zur Disposition.

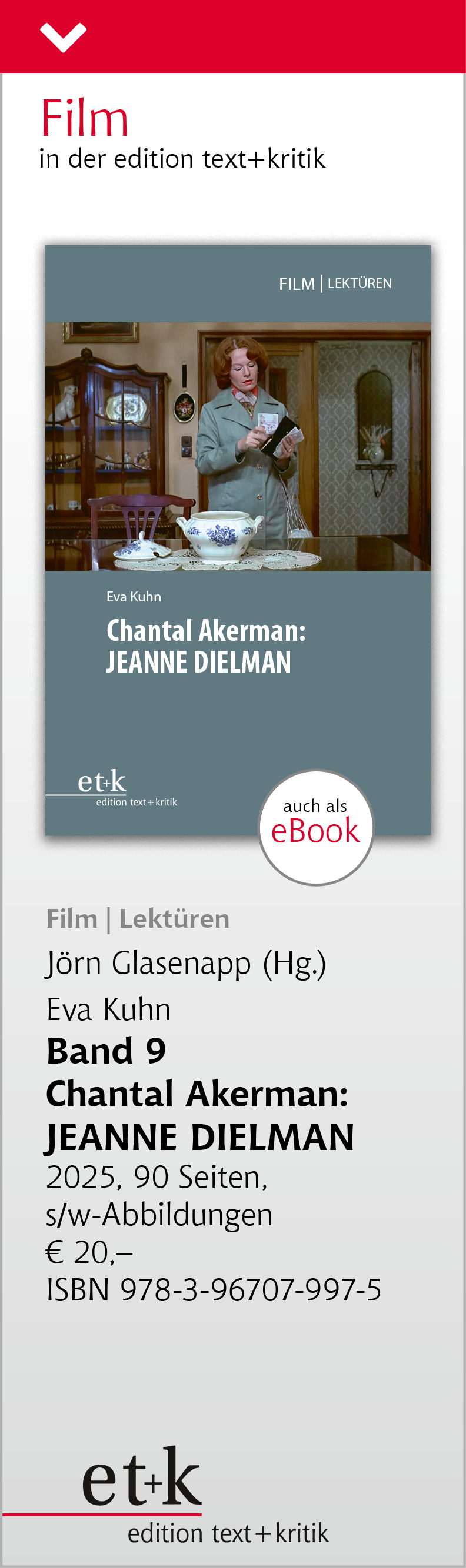

Ihre Meinung ist gefragt, Schreiben Sie uns