Wie es sich gehört für ein Wunderkind, mischt der der 25-jährige Kanadier Xavier Dolan in letzter Minute noch einmal den Wettbewerb neu auf. Die Favoriten waren schon gesetzt - Nuri Bilge Ceylan mit Winter Sleep, Mike Leigh mit Mr Turner, Abderrahmane Sissako mit Timbuktu an der Spitze - da gibt es einen neuen Favoriten, zumindest in den Herzen der Kritiker. Man kann es nicht anders als mit Ironie sagen: Mommy ist bereits Xavier Dolans fünfter Film und er damit eigentlich schon ein alter Hase. Doch sein Film zeigt eben jene Frische, Frechheit und Unberechenbarkeit, die eben nur Newcomer oder echte Außenseiter liefern können.
Wie schon in Dolans Erstlingswerk geht es auch in Mommy um eine Mutter-Sohn-Beziehung der allzu intensiven Art. Wobei diesmal die Figur der Mutter im Vordergrund steht. Diane (Anne Dorval) ist eine verwitwete Alleinerziehende, die sich wie ein Teenager kleidet und von niemandem das Wort verbieten lässt.

Ihr Sohn Steve (Antoine-Olivier Pilon) ist ein unbändiger 16-Jähriger mit diversen Diagnosen von ADHS bis Borderline-Asperger. Für ihre Umgebung sind sie ein Paar aus der Hölle. Ihr Zusammenleben ist geprägt vom Fatalismus des “nicht ohne und nicht miteinander”. Für einige Zeit gelingt es durch den besänftigenden Einfluss einer Nachbarin eine unerwartete Balance zu schaffen. Die Nachbarin Kyla (Suzanne Clément) hat eigene Probleme: seit einem psychischer Zusammenbruch stottert sie, was sie als Lehrerin berufsunfähig macht. Mit einer Emotionalität, die sich auch in der Bildsprache niederschlägt, schildert Dolan nun, wie sich diese Drei zunächst ein unstabiles Glück erkämpfen, dem unweigerlich ein schlimmes Ende droht.
Mommy ist ein Film, der niemand kalt lässt: wo die einen sich genervt abwenden ob der überbordenden, lauten Ausdruckskraft, fühlen die anderen sich gefesselt von Dolans stilistischen Wagemut.

Eine in diesem Jahr besonders gute Programmierung brachte den Junior des Wettbewerbs mit dem Senior zusammen. Der Andrang für das neueste Werk des 83-jährigen Jean-Luc Godard war dabei doch noch größer als der für Dolan. Mit Adieu au langage lieferte der Nouvelle-Vague-Mitbegründer erneut einen Essayfilm, der Filmschnipsel aller Art mit einem bunten Zitate-Teppich aus Kunst und Kunstkritik verbindet, diesmal zusätzlich noch in 3D.
Für die einen ergab das alles viel - gesellschafts- und filmkritischen - Sinn, andere bekamen angesichts von Doppelbelichtungen in 3D eher Kopfschmerzen. Am Ende aber blieb die einigende Ovation, und damit die für den Altmeister der Provokation sicher mit Wermutstropfen verbundene Erkenntnis, dass sein Werk heutzutage eben das Publikum nicht mehr spaltet, sondern in einer Mischung aus Nachsicht und Respekt zusammenbringt.
Die Gesellschaftskritik, die Godard mit seinem Film anstrebt, lieferten andere Filme im diesjährigen Wettbewerb mit mehr Effekt und größerer Klarheit. Letzteres nämlich erweist sich als der zentrale Trend der Filmfestspiele von Cannes 2014. Von Mike Leighs Maler-Biopic Mr. Turner über David Cronenbergs Hollywoodsatire Maps to the Stars bis zu den Arbeitern in Two Days, One Night und dem psychotischen Millionenerbe in Bennett Millers Foxcatcher: Immer wieder widmeten sich die Filme in Cannes in diesem Jahr dem Thema der Privilegien und was sie bedeuten für den, der sich ihrer erfreut und für diejenigen, die sich davon ausgeschlossen finden.
Als Meister der subtilen Analyse solcher Machtverhältnisse erwies sich allerdings der türkische Regisseur Nuri Bilge Ceylan mit seinem Drei-Stunden-Magnum-Opus Winter Sleep. In seinen ausufernden Dialogen und Szenen gelingt es Ceylan, jene verborgenen Gesellschaftsstrukturen sichtbar zu machen, in denen anatolische Traditionen, moderne Umbrüche und deren Niederschlag auf die Psyche zusammenkommen. Neben Newcomer Mommy bleibt Ceylan deshalb Hauptfavorit auf die Goldene Palme.
Außenseiterchancen werden unterdessen der großen Neuentdeckung dieses Festivals zugeschrieben: Timbuktu von Abderrahmane Sissako, der in Tableaus von magnetischer Schönheit die Machtergreifung durch Dschihadisten schildert. Sissako mischt großes Kino mit sanfter Ironie, leisen Humor mit schockhafter Deutlichkeit. Einem Festival, das sich seiner cineastischen Entdeckungsmacht rühmt, während es Jahr um Jahr die gleichen alten Meister einlädt, stünde eine Goldene Palme für den Mauretanier jedenfalls sehr gut an.


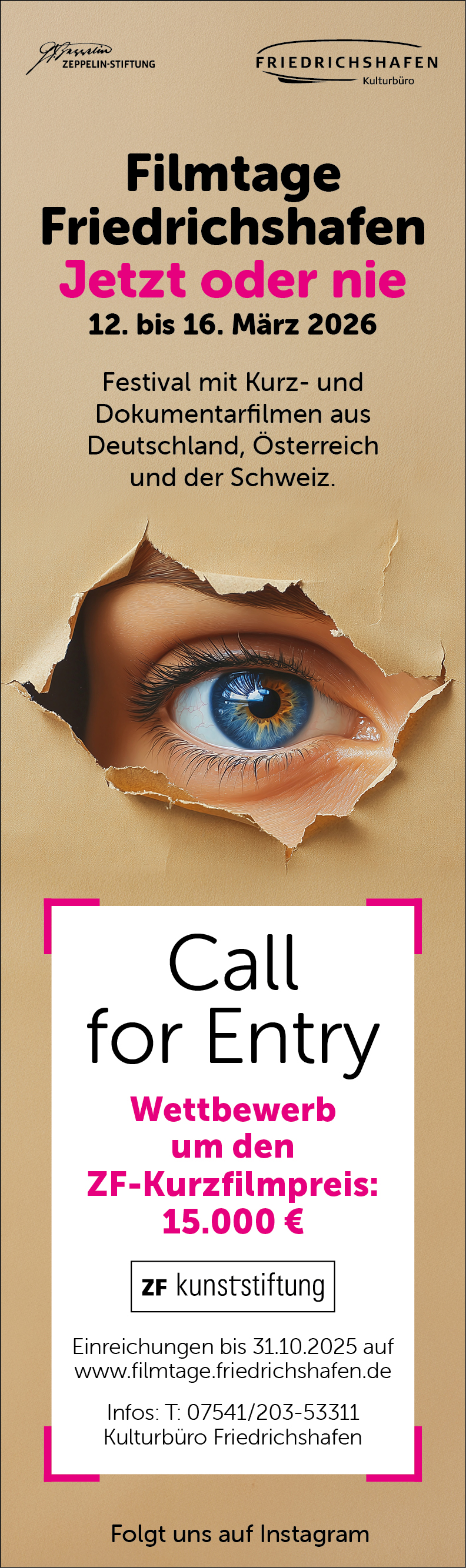


Ihre Meinung ist gefragt, Schreiben Sie uns