Alfred Hitchcock

© Fred Palumbo (1956)
Die Filmfestspiele von San Sebastián zeigten in diesem Jahr auch die Ausstellung »Welcome Mr. Hitchcock«. Vier Tage lang hat im Jahre 1959 ein Fotograf den Regisseur, dessen Vertigo im Wettbewerb lief, durchs Baskenland begleitet. Es gibt kaum ein Foto, auf dem Hitchcock nicht posiert, sich selbst inszeniert. Kein anderer Regisseur der Filmgeschichte hat seine Physiognomie so sehr als Marketinginstrument verwendet wie der master of suspense. In »
Hitchcock« (2012) von Sacha Gervasi ahmt Anthony Hopkins dessen Posen so lebensecht nach, dass seine Figur fast schon wie eine Karikatur wirkt. Hitchcock dreht sich um die Produktion von Psycho. Kein anderer Regisseur hat seine Filme so zum Spiegel seiner Abgründe gemacht wie Hitchcock. Der britische TV-Film »
The Girl«, im selben Jahr herausgekommen, zeigt einen obsessiveren Hitchcock (Toby Jones), mit einem sadistischen Verlangen nach seiner Hauptdarstellerin Tippi Hedren, ein Svengali außer Kontrolle.
von Rudolf Worschech
Mark Zuckerberg

© Guillaume Paumier (2011)
Bei Leinwandverkörperungen prominenter Persönlichkeiten vollzieht man als Zuschauer automatisch einen Abgleich: Sieht Michael Fassbender Steve Jobs nicht täuschend ähnlich? Bei Jesse Eisenberg und Mark Zuckerberg lief es umgekehrt: Weil der echte Zuckerberg bis zu »
The Social Network« kaum in Erscheinung getreten war, prägte Eisenbergs filmisches Porträt unser Bild (und das Image) des echten Menschen. Eisenberg musste nicht einmal in die Maske, um Haare oder Kinn anzugleichen. Er sah aus wie immer, weil sowieso niemand Zuckerbergs Jedermann-Gesicht vor Augen hatte. Allerdings entsprachen Eisenbergs nerdige Physis und seine verkniffene, selbstgefällig-arrogante Ausstrahlung auch so schon exakt dem Bild, das man mit einem jugendlichen Internetgenie verband. Anders gesagt gelang es ihm, jenseits von Mimikry die charakterliche Essenz der (Film-)Figur greifbar zu machen. Die Frage lautete denn auch nicht, ob Eisenberg Zuckerberg exakt getroffen hatte. Sondern der getroffene Zuckerberg musste beweisen, dass er nicht so war, wie Eisenberg ihn interpretierte.
von Kai Mihm
Barack Obama

© Pete Souza (2012)
Berühmte Persönlichkeiten zu spielen, ist immer eine Herausforderung, erst recht wenn sie schon in Wirklichkeit so cool und charismatisch sind, dass man am liebsten das Original sehen würde. Parker Sawyers empfahl sich durch eine frappierende äußere Ähnlichkeit mit dem jungen Barack Obama für »
My First Lady« und hatte dazu noch eine eindrucksvolle Obama-Imitation im Repertoire. Doch Regisseur Richard Tanne wollte keine Kopie, sondern eine Darstellung und forderte, dass er einfach nur den Typen im Drehbuch spielt, der ein Mädchen für sich gewinnen will: »Bei biografischen Filmen verlassen sich die Schauspieler oft viel zu stark auf gewisse Manierismen und Ticks, die eine reale Person identifizieren.« Das, was die Erscheinung des heutigen Präsidenten ausmacht, schimmert bei diesem engagierten, jungen Rechtsanwalt also subtil durch: die aufrechte Haltung, die lässige Präsenz und die Gesten, mit denen er seine Reden akzentuiert.
von Anke Sterneborg
François Mitterrand

© James Cavalier (1984)
Mit lüsterner Ehrfurcht berührt der Präsident in »
Letzte Tage im Elysée« den kalten Marmor, ohne Scheu streicht er über die Gesichtszüge der Figuren. In der Basilika von Saint-Denis, der Grabstätte der französischen Könige, fühlt er sich im Kreis seiner Ahnen: ein vom Volk gewählter Monarch. François Mitterrands (Michel Bouquet, Bild) Identifikation mit den Ruhenden geht noch tiefer. Er ist ergriffen von der Doppeldeutigkeit des eigenen Körpers. Dieser ist einerseits abstrakt, das Amt macht ihn zum Nationalgut. Zugleich spürt er seine Hinfälligkeit, der Krebs lässt ihm nur noch wenige Monate, um sein Haus zu bestellen. Er hatte ein bemerkenswertes Kinoleben. Jean-Louis Trintignant spielte ihn zwei Jahre nach seinem Amtsantritt schon als Verfasser glühender Liebesbriefe, Jean D'Ormesson hob 2012 seinen kulinarischen Feinsinn hervor. Bouquet zieht 2005 souverän die Summe daraus, zelebriert ihn als als kennerischen Liebhaber französischer Geschichte und Landschaften, als raffinierten Sinnenmenschen.
von Gerhard Midding
Andreas Baader
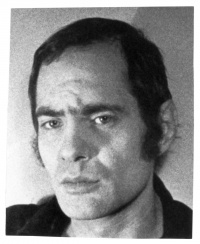
© Stiftung Haus der Geschichte der BRD
In Deutschland sind, sieht man einmal von Adolf Hitler ab, historische Persönlichkeiten vor allem Sache des Fernsehens. Willy Brandt, Axel Caesar Springer, Luis Trenker, Erwin Rommel – historisch meist ziemlich korrekt. Um den historischen Background schert sich Christopher Roth in seinem »
Baader« (2005) wenig, ganz anders als der spätere »
Der Baader-Meinhof-Komplex«. Der viel zu früh verstorbene Frank Giering spielt den Topterroristen, Laura Tonke die Gudrun Ensslin. Es ist gewissermaßen eine historische Projektion: eine Studie in Sachen RAF-Style. Roth lässt seine Figuren agieren, als wollten sie »
Bonnie and Clyde« imitieren. Coole Rebellen. Da mag manches erstunken und erlogen sein – Baader geht es um ein Lebensgefühl, mit schnellen Autos und Zigarette im Mundwinkel.
von Rudolf Worschech
Sieben Mal Nixon

© Oliver F. Atkins (1971)
Geometrische Geheimratsecken, stechender Paranoiablick und eine leicht gebückte, angriffslustige Haltung – diese drei Attribute sind der kleinste gemeinsame Nenner in den sieben Kinofilmen, in denen Richard Nixon in Erscheinung tritt. Auch in der neuen »
Elvis & Nixon«-Komödie erweist sich der 1974 wegen der Watergate-Affäre zurückgetretene 37. US-Präsident als nach wie vor zuverlässig faszinierender Schurke. Kevin Spacey verkörpert ihn als Getriebenen, der in dem still verrückten Rock 'n' Roller Elvis unerwartet einen reaktionären Seelenverwandten entdeckt.
Das Nixon-Hochamt ist natürlich Oliver Stones Nixon-Biografie von 1995, in der Anthony Hopkins mit Hannibal-Lecter-haftem Zähneblecken im Oval Office Angst und Schrecken verbreitet. Stones unterhaltsam hysterische Inszenierung verlieh dem Präsidenten eine Shakespeare'sche Tragik – so in Richtung »Richard III.«. In jeder Sekunde spürt man, dass Nixon ein Charakter nach Stones Geschmack ist: ein Dampfkessel kurz vorm Explodieren, einer, der unflätige Schimpfwörter herauspresst, genial und verblendet genug, sich selbst ein Bein zu stellen.

»Nixon« (1995)
Doch während Hopkins wirkt wie Hopkins, der einen madman spielt, ist Dan Hedaya in der Komödie »Ich liebe Dick« (1999) Nixon optisch viel ähnlicher. Mit subversiv-albernem Humor decken darin zwei für Nixon schwärmende Girlies zufällig die Watergate-Affäre auf. Dabei wird nicht nur dem onkelhaften und reizbaren Präsidenten, sondern auch den legendären Enthüllungsreportern Woodward & Bernstein eins mitgegeben.
Wenig erwähnenswert ist leider Robert Altmans One-Man-Tirade »Secret Honor« (1984), in der Philip Baker Hall als Nixon kurz vor dem Rücktritt ohne größeren Erkenntnisgewinn und als unfreiwillig komische Karikatur flucht, zischt und säuft. Auch Christopher Shyer hinterließ 2011 im Filmporträt eines weiteren Besessenen, Clint Eastwoods »J. Edgar«, als Nixon, der Hoover als cocksucker beschimpft, wenig Eindruck, war aber der bisher hübscheste Nixon. 2013 erscheint Nixon, gespielt von John Cusack, in der Präsidentenparade, die »The Butler« Forest Whitaker im Weißen Haus bedient, als peinlich halbverrückter Buhmann. Spannender ist Frank Langella in »Frost/Nixon« (2008), wenn er Nixons charmante »Tricky Dick«-Seite ausspielt.
Und nun kann man schon mal Wetten darauf abschließen, wer in den kommenden Jahren den Donald geben darf.
von Birgit Roschy
Blair & Frost & Masters & Clough

© Marc Müller (2014)
»Pretty heartfelt for a fucking war criminal«: So hat kürzlich jemand auf YouTube die kleine Rede kommentiert, in der Tony Blair seine tiefe Betroffenheit über den Tod von Diana Spencer ausdrückte. Der britische Politiker war immer einer, der sich zu inszenieren wusste. Das wird bereits in Stephen Frearsʼ und Peter Morgans Fernsehfilm »
The Deal« von 2003 deutlich, der vom Aufstieg der Labour-Politiker Gordon Brown und Tony Blair erzählt – und von den Verhandlungen, die nach dem plötzlichen Tod des beliebten Parteichefs John Smith 1994 dazu führten, dass Blair Labour-Vorsitzender und britischer Premier wurde. Michael Sheen spielt den jungen Blair als undurchsichtigen, aber keineswegs dämonischen Karrieristen mit sorgfältig modulierter Stimme und einem Lächeln, das in sein Gesicht einschlägt wie ein Blitz – ein Medien-Darling mit eingebautem Charm-o-Mat, ganz anders als David Tennants hemdsärmeliger Gordon Brown.
Die Rolle wuchs sich für Sheen zur Blair-Trilogie aus. In »The Queen« (ebenfalls von Frears und Morgan) lässt er sich als frisch inaugurierter Staatschef eilfertig – »This is going to be huge« – von der Welle der Diana-Verehrung emportragen; »The Special Relationship« (Richard Loncraine, Peter Morgan), der problematischste Film der Serie, erzählt vom Verhältnis zwischen Bill Clinton und Tony Blair in der Endphase des Balkankriegs – eine unheilige Allianz, deren Politik bis heute nachwirkt.

»The Queen« (2006)
Blairs Art, Krawatte und Revers zurechtzuzupfen, seine Kunstpausen und den näselnden, BBC-kompatiblen Tonfall konnte Michael Sheen in sein Porträt des legendären englischen Talkmasters David Frost in »Frost/Nixon« einspeisen. Wieder ein Medientyp, exzessiv bereits von den Pythons parodiert; dieses Mal aber einer, der über sich hinauswächst: Schließlich hat Frost Richard Nixons Watergate-Lügen vor laufender Kamera demontiert. Die Szene erscheint im Film emphatischer, als sie war: Man kann das heute alles Wort für Wort und Bild für Bild im Internet miteinander abgleichen.
Für Michael Sheen sind impersonations die Krone des Handwerks: »Thatʼs what separates the men from the boys«, hat er mal gesagt. Inzwischen ist er zum Spezialisten für Biopics und artverwandte Produktionen geworden: In »The Damned United« spielte er den Fußballtrainer Brian Clough, in der Serie »Masters of Sex« den Gynäkologen William Howell Masters. Die sind vielleicht nicht so prominent, dass man die Realness der Performance wirklich bewerten könnte. Unterhaltend sind sie aber allemal.
von Sabine Horst
Ray Charles

© Rob Bogaerts (1983)
Als Komiker hatte Jamie Foxx schon viele berühmte Persönlichkeiten imitiert, also eine gewisse Übung darin, die Essenz eines Menschen zu destillieren: »In einem Film nimmt man das einfach ein paar Grade zurück und spielt ihn so, als sei der Charakter eben nicht in der Öffentlichkeit, sondern privat zuhause. Da geht es darum, so fein zu nuancieren, dass er keine Imitation mehr ist, sondern zu einer realen Person wird.« Die kantigen Wiegebewegungen am Klavier, das hochgereckte Kinn, der ins Leere gehende Blick unter der schwarzen Brille, die Art wie er die Welt über Geräusche und Schwingungen erspürt: Hingebungsvoll erfasst der Schauspieler in Taylor Hackfords Ray den ganzen Soul und Blues von Ray Charles und wurde für seine Mimikry mit dem Oscar ausgezeichnet. Und das, obwohl er beim Spielen der blinden Musikerlegende auf eines der wichtigsten Werkzeuge verzichten musste, die Augen.
von Anke Sterneborg
Hit and Miss: Trump und Sarah bei »Saturday Night Live«
Neben vielem anderen hat auch der Glaube an die subversive Kraft der Comedy am 9. November dieses Jahres einen schweren Schlag erlitten. Dabei sah Anfang Oktober alles noch so rosig aus: Im Anschluss an die erste Debatte der Präsidentschaftkandidaten Trump und Clinton hatte die Comedy-Sendung »Saturday Night Live« mit Alec Baldwin als Trump-Nachäffer endlich ein echtes Schwergewicht ins Spiel gebracht. Sein Vorgänger »im Amt«, der 34-jährige Taran Killam hatte in der vorherigen Saison Donald Trump noch als relativ sonniges, wenn auch derangiertes Gemüt angelegt; es war eine Satire ohne Biss. Baldwin (58) dagegen nahm die »orange Bedrohung« endlich mit gebührendem Ernst auf sich. Seine Trump-Impression war so präzise in Gestik, Mimik, Tonfall, dass das höchste Ziel der Comedy erreicht wurde: Das Lachen blieb einem als Zuschauer im Halse stecken. Mehr als die reine äußere Nachahmung gelang es Baldwin dabei, die Engstirnigkeit und Niederträchtigkeit, das Kindische und das unterschwellig Rassistische in den ach, so amüsanten Repliken Trumps sichtbar zu machen. Baldwins eigener konservativer Bruder Stephen zeigte sich »not amused«. Und Trump höchstselbst erging es ähnlich: Er forderte auf Twitter dazu auf, die Show einzustellen. Was den Glauben daran, dass ein solcher Akt von Entlarvung und Selbstentlarvung nicht ohne Folgen aufs Wahlvolk bleiben könnte, noch bestärkte. Oh, schöne Illusion!
Dafür, dass es diese Illusion gab, ist eine andere Politiker-»Impression« des »SNL«-Programms verantwortlich. Damals, im September 2008 hatte der republikanische Kandidat John McCain gerade Sarah Palin als seine Vizepräsidentin vorgestellt, als die Welt entdeckte, dass Palin in der versierten Komikerin Tina Fey eine Doppelgängerin von verbüffender Ähnlichkeit hatte. Bereits der erste Auftritt von Fey als Palin wurde zum viralen Hit und resultierte für Palin in messbarem Imageschaden. Dabei hatte Fey wenig mehr getan, als etwa Palins Neigung, die Nähe ihres heimischen Alaska zu Russland als Ausgleich für ihre mangelnde außenpolitische Erfahrung anzuführen, in einen Satz wie: »I can see Russia from my house« zu fassen. Bis heute muss die echte Palin dementieren, das je so gesagt zu haben.
Was die echte Palin damals auch noch »musste«: in einem der nächsten Sketche bei »SNL« mitmachen und so ihre Fähigkeit zur Selbstironie beweisen. Das galt 2008 als »fair game«. Wie sehr sich die Zeiten inzwischen verändert haben, zeichnete sich am 7. November des vorherigen Jahres ab. Da hatte »SNL« den Kandidaten Trump als Gaststar eingeladen – wofür die Sendungsverantwortlichen bis heute mit giftiger Kritik überschüttet werden. Sie hätten einen Rassisten und Frauenverächter durchs Herumscherzen mit ihm »humanisiert« und damit erst wählbar gemacht, heißt es.
von Barbara Schweizerhof
Jackie Kennedy

© Abbie Rowe (1961)
Jackie Kennedy gehört zu jenen Personen der Zeitgeschichte, die man schon an ihren Accessoires erkennt: Dem »Pillenhut« oder dem zugehörigen rosafarbenen Chanel-Kostüm, das sie etwa am Tag des Attentats auf ihren Gatten trug. Für Pablo Larraíns
»Jackie« aber hat Natalie Portman es nicht dabei belassen einfach in die wiedererkennbaren Kleider zu schlüpfen, sie hat Jackies Ausdrucksweise und Haltung studiert bis in die kleinen Nuancen hinein: dieser gehauchte, unschuldig verführerische Ton, diese vibrierende Unsicherheit hinter dem perfekten Äußeren, die sichtbare Medienunerfahrenheit, die sich als Gestelztheit in ihren Fernsehauftritten niederschlug – das alles ahmt Portman in höchster Vollendung nach. Und dann setzt sie eins drauf, wenn sie in »privaten« Szenen des Films die »Eiskönigin« Jackie aufblitzen lässt, eine machtbewusste Frau, die mit Zigarette in der Hand ihr Gegenüber abfertigt.
von Barbara Schweizerhof







Ihre Meinung ist gefragt, Schreiben Sie uns